In der Kriegszeit vom 1. April 1940 bis zum 20. Dezember 1945 wurde in Altendorf keine Schulchronik geführt. Die Kinder aus Altendorf und Benitz wurden in dieser Zeit in Brome beschult, da viele Lehrer, wie auch die meisten anderen wehrfähigen Männer, zum Kriegsdienst eingezogen worden waren. Der Lehrer Hermann Büttner war nach Kriegsende als Flüchtling nach Altendorf gekommen und begann seinen Dienst an der Volksschule mit deren Wiedereröffnung am 20. Dezember 1945.
Büttner bedauerte sehr, dass in der Chronik „… für die Gemeinde Altendorf so viele gewaltige und dabei so folgenschwere Ereignisse… nicht festgehalten waren“. So machte er sich daran, seine neuen Mitbürger in Altendorf über diese Zeit zu befragen und die Ergebnisse dieser Befragungen in die Schulchronik aufzunehmen. Aus diesen Berichten notierte Büttner, was sich in der Gemeinde Altendorf getan hatte.
Wie in anderen Gemeinden und Städten in Deutschland wurden Kriegsgefangene aus den ersten siegreichen Kriegsjahren als Arbeitskräfte eingesetzt. In Altendorf arbeiteten sie in der Landwirtschaft und hatten es damit meistens besser getroffen als ihre Leidensgenossen, die in anderen Bereichen Zwangsarbeit leisten mussten. Junge Bauern und Landarbeiter waren im Kriegsdienst, viele inzwischen bereits verwundet oder sogar gefallen. Mit der Arbeit der Gefangenen sollte ein Ausgleich geschaffen und die Produktion in der Landwirtschaft aufrechterhalten werden.
Wegen der allgemeinen Verknappung der Lebensmittel wurden Lebensmittelkarten eingeführt, durch die eine gleichmäßige Verteilung der Grundnahrungsmittel erreicht werden sollte. Da die Versorgung auf dem Land naturgemäß besser war als in den Städten, machten sich viele Stadtbewohner mit sog. Hamsterfahrten auf den Weg in die Dörfer. Um ein paar zusätzliche Lebensmittel zu erhalten, kamen auch etliche Leute nach Altendorf. Ansonsten ging das Leben hier seinen gleichmäßigen und ruhigen Gang. „Von den Schrecken des fortschreitenden Krieges bekam das Dorf in den ersten Kriegsjahren nichts zu spüren“.
Schließlich versuchten immer mehr Menschen aus den Städten, auf dem Lande Zuflucht zu nehmen. Auch ganze Schulklassen mit den sie begleitenden Lehrkräften wurden im Rahmen der Kinderlandverschickung dorthin geschafft. Von der Wolfsburger Mittelschule wurden drei Klassen ausquartiert. „2 Klassen wurden in Brome untergebracht und eine in Altendorf“.
„Einen kleinen Begriff von den Schrecken, die die Stadtbewohner bei dem zunehmenden Luftterror durchzumachen hatten, bekam auch unser Dorf gegen Ende des Krieges zu spüren. An einem Novemberabend im Jahre 1943 … ließ ein feindliches Flugzeug auf die Benitzer Feldmark… eine Luftmine, zwölf Phosphorbomben und ungefähr 100 Brandbomben fallen“.
„Im Januar 1945 … warf ein feindliches Flugzeug im Notwurf 10 Bomben beiderseits der Altendorf-Benitzer Chaussee“. „Ende März 1945 … fielen 2 Bomben auf den Acker des Bauern Rehfeldt in Benitz“, verursachten zum Glück aber nur Flurschaden.
„Am 22.2.1945 … stürzte ein amerikanischer viermotoriger Bomber, der in Luftkämpfen abgeschossen worden war, in der Nähe der Altendorfer – Wiswedeler Straße … ab“. Die Flugzeugteile lagen weit verstreut. „Von den 9 Insassen des Flugzeuges retteten sich 6 durch Fallschirmabsprung. 2 Mann lagen tot unter der Maschine, ein dritter 20 m entfernt, ebenfalls tot. Der eine Abspringer landete auf Dieckmanns Scheunendach, riß dabei ein Loch ins Dach…“ Der Verwundete wurde verbunden und der Polizei übergeben.
Seit dem Frühjahr 1944 häuften sich die Angriffe feindlicher Tiefflieger auf die Kleinbahnstrecke der OHE. Bei diesen Vorfällen waren Verwundete und Tote zu beklagen, Altendorfer Bürger gehörten nicht zu den Opfern.
Was sich dann im Frühjahr 1945 in seiner neuen Heimat ereignete, hielt Hermann Büttner ebenfalls fest: „Daß der Krieg seinem schrecklichen Ende entgegenging, zeigte der erste Flüchtlingstransport, der hier Anfang Februar ankam. Er war aus Berlin gekommen. Frauen und Kinder wollte man dort fortbringen. Ein langer Zug rollte in den Kreis Gifhorn und wurde auf allen Bahnhöfen entlang der Strecke Oebisfelde – Wittingen entladen“. Auch die Frau des Lehrers Büttner kam mit ihren drei Kindern auf diese Weise hier an.
Von den Altendorfern wurden die ersten Flüchtlinge herzlich und liebevoll aufgenommen, allerdings blieben das nicht die einzigen Flüchtlinge. Nach zwei Wochen setzte der Flüchtlingsstrom aus dem Osten ein und damit kamen auch immer mehr Menschen nach Altendorf. Viele dieser Menschen waren lange Strecken zu Fuß gegangen oder mit Wagen quer durch Deutschland gefahren und suchten nun irgendwo eine Bleibe. „Wochenlang, seit Mitte Januar, waren sie bei Wind und Wetter, Frost und Schneesturm unterwegs gewesen, hatten kein anderes Dach über dem Kopf gehabt, als den Wagenplan, waren erschöpft, krank, die Pferde abgetrieben, klopften nun an die Tore der hiesigen Bauernhöfe, baten um Aufnahme und wurden aufgenommen. Bald war jeder Hof, auch der kleine, mit Flüchtlingen voll belegt.“ „Viele Wochen dauerte dieser Flüchtlingsstrom an“.
Im April 1945 waren die vorrückenden Amerikaner in den Kreis Gifhorn gelangt und am 11. April fuhren erste amerikanische Panzer durch Altendorf. In den Tagen danach war „die Kampflage vollständig undurchsichtig“ notierte Hermann Büttner.
„So durchfuhr am 16.4. eine deutsche Abteilung, bestehend aus 5 Panzern und ungefähr 25 Lastwagen, Altendorf und nahm für kurze Zeit in der näheren Umgebung Aufstellung.“ Glücklicherweise kam es zu keinen Kampfhandlungen, so dass „…keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben“ bestand.
Ein Teil eines größeren Gefangenentransports von mehreren tausend Russen und Franzosen, die von Westen kommend, in die Altmark gebracht werden sollten, machte in Altendorf Station. „Während der Nacht wurden sie in den Scheunen der Bauern einquartiert. So waren auf Bromanns Hof 180 Franzosen, auf Fritz Knokes Hof 200 gefangene Russen untergebracht“. Beim Weiterzug gerieten die Gefangenen und ihre deutschen Bewacher bei Wendischbrome und Radenbeck in das Feuer feindlicher Panzer. „Bei dem nun entstehenden Wirrwarr und dem allgemeinen Durcheinander sprengten sowohl Wachmannschaften, als auch Gefangene, nach allen Seiten auseinander“. Die ehemals Gefangenen verstreuten sich in der Gegend und verlangten von den Dorfbewohnern Unterkunft und Verpflegung. In der aufgeladenen und spannungsreichen Atmosphäre gab es viele gefährlichen Situationen, auch Plünderungen und Messerstechereien kamen vor. Die Russen hielten sich mehrere Tage hier auf, bis sie weiterzogen. Als sich schließlich stärkere amerikanische Kräfte näherten, wurden von ihnen Ruhe und Ordnung wiederhergestellt.
Historisch gesichert ist, dass die russischen Kriegsgefangenen doppelt unter die Räder des Kriegsgeschehens gerieten. Ihre Gefangennahme wurde von dem stalinistischen System als „Vaterlandsverrat“ eingestuft und wie ein mit Absicht begangenes Verbrechen behandelt. So führte ihr Weg in der Heimat meistens gleich in sibirische Straflager.
Hermann Büttner hielt auch fest, dass sich Polen, die bei den hiesigen Bauern zwangsbeschäftigt waren, an Plünderungen beteiligten. Einzelne Polen und eine Baltin konnten aber auch im Konflikt mit Russen vermittelnd und beschützend eingreifen. Über den Verbleib der Franzosen ist in der Chronik nichts zu lesen, womöglich waren sie unauffälliger und sind so schnell wie möglich auf irgendwelchen Wegen in ihre Heimat zurückgekehrt.
„Am 24.4.45 wurde Altendorf dauernd besetzt, zunächst von den Amerikanern, später von den Engländern“. Drei Bauernhöfe wurden mit Truppen belegt. „Auf Bromanns Hof waren 15 Panzer aufgestellt“. Die Bauernfamilien mussten die Höfe verlassen, durften nichts mitnehmen und die Ställe nur zum Füttern des Viehs betreten.
Die Besetzung Altendorfs dauerte vier Wochen. Auf der Straße zwischen Brome und Radenbeck fuhren Panzer mehrere Male am Tag Patrouille und von 22 Uhr bis 5 Uhr herrschte Sperrzeit, in der sich kein Zivilist auf der Straße aufhalten durfte.
Monatelang gab es keine Möglichkeit, Nachrichten zu übermitteln, da der Post- und Bahnverkehr ruhte. Wollte man in einen anderen Ort, konnte man den nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.
„Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen, waren in diesen Monaten unterwegs“. Entlassene Soldaten oder solche, die sich heimlich entfernt hatten, schlugen sich durch, evakuierte Städter wollten endlich zurück in die Heimatstädte. Flüchtlinge wollten zu ihren Verwandten, die es anderswohin verschlagen hatte. „Alles wanderte schwer bepackt, tagelang, wochenlang. Einzeln, in kleineren u. größeren Gruppen durchzogen sie unser Dorf“.
So war die kleine beschauliche Gemeinden Altendorf, deren Bewohner sich so weit entfernt von den Wirren des Krieges glaubten, doch noch Schauplatz kriegerischer Ereignisse und seiner Nachwirkungen geworden. Der Krieg, der von Deutschland aus in die Welt gegangen war, hatte auch hier seine Spuren hinterlassen, wenn auch in weitaus geringerem Maße, als in den Städten und den Gebieten, über die der Krieg grausam hinweggefegt war. Zeitzeugen, die sich zu den damaligen Geschehnissen äußern könnten, sind entweder verstorben oder hoch betagt, so dass sich ihre Erinnerungen verwischt haben. Dem Lehrer Hermann Büttner gebührt für diese Aufzeichnungen in der Altendorfer Schulchronik, Band II, großer Dank, denn ohne sie wäre das Wissen um die Geschehnisse dieser Zeit in Altendorf und Umgebung verloren gegangen.





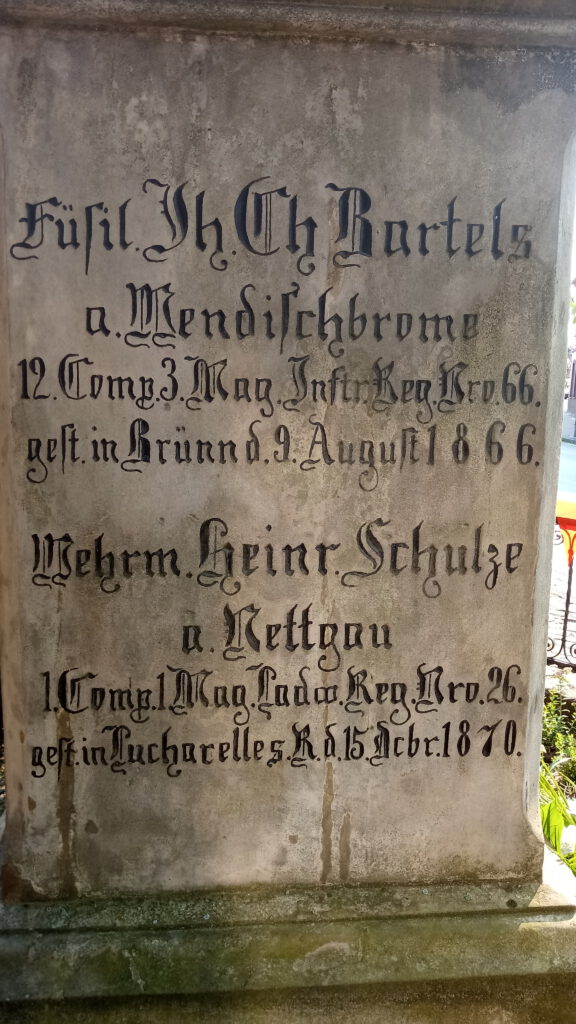
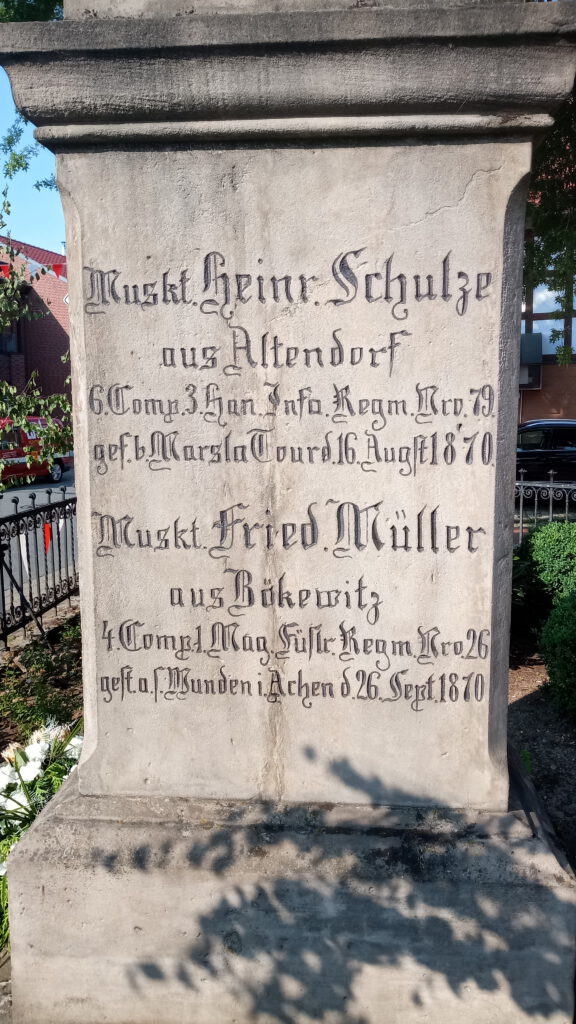






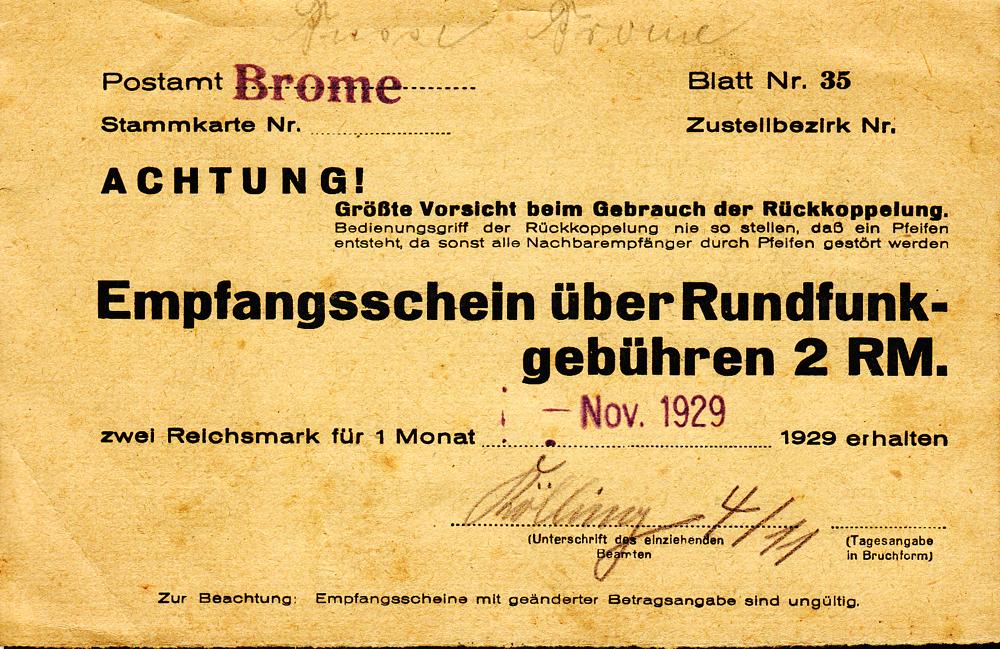

Neueste Kommentare